DIE NACHBARN DER DEUTSCHEN
[...] Morgens fahre ich in der U-Bahn, lese „Saints and Sinners“ von Edna O'Brien, lasse den Blick nach draußen
schweifen, lasse ihn auf die Sitzbank gegenüber schweifen und plötzlich höre ich nicht mehr den Verkehr der Autos, die sich neben der U-Bahn in das Tal kämpfen, sondern nur noch das Gespräch, das dort drüben stattfindet:
„...Ich bin Deutsche, ja, und das ist einfach
so...“, sagt sie.
Der Mann, der ihr gegenüber sitzt, untersetzt,
graue, raspelkurze Haare, eine Hornbrille, Jeans, ein Bauch, der sich hinter
den Knöpfen des karierten Hemdes offensichtlich eingesperrt fühlt, dieser Mann
nickt aufmerksam.
„...weil, was soll das mit dem 'Ihr seid alle
Europäer', ich bin Deutsche, ich spreche Deutsch, also bin ich deutsch“,
sagt sie, blond gefärbt, verrauchtes und gegerbtes Gesicht, Leopardenleggings,
die sie nicht jünger wirken lässt, wie sie annimmt, sondern älter, viel älter.
Und sie sofort einer Schicht zuordnet, die mit ihren Aussagen zusammenpasst.
Leider.
Ich schüttele den Kopf und krame in meinen Gedanken
nach Zwischenrufen, die man so gerne nicht rufen, sondern schreien würde: „Ich hoffe, Sie haben dann noch nie eine Reise ins Ausland gemacht, eine
Reise über Grenzen hinweg!“ oder „Ich hoffe, Sie essen nicht gerne
Döner oder Gerichte, die nicht aus Deutschland stammen, dann wären Sie nämlich
ganz schön europäisch!“ oder dieser Satz, der zwei Stationen, nach dem die
beiden ausgestiegen sind, im Kopf erscheint: „Haben Sie das schon einmal
zu Ende gedacht, was das heißt, wenn Sie sagen, Sie sind keine Europäerin, Sie
sind nur Deutsche? Heißt das, wir sollen alle Grenzen zumachen? Heißt das, Sie
müssen Ihren Reisepass abgeben, heißt das, man kann Sie für den Kontakt mit
anderen Nationen Europas oder gar der Welt anklagen? Heißt das, wir müssen
unsere geschlossenen Grenzen vor dem 'Feind' schützen, Krieg beginnen?“
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob ich „Nachbarn“
nicht noch erweitern soll. Irgendwie fühlt sich die Geschichte fertig an und
ich möchte sie nicht kaputt machen, aber in Wahrheit ist sie veraltet: die
Schwarzen, die aus Afrika kommen und Asyl suchen sind längst nicht mehr das
Ende der Nahrungskette, was (Alltags-)Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
angeht. Es sind offensichtlich mittlerweile die Menschen, die aus dem Nahen
Osten kommen, flüchten, weil sie dort verfolgt werden, erschlagen und getötet.
Und weil sie hier von Menschen, denen es gerade Recht kommt, dass
Fremdenfeindlichkeit durch Terroranschläge und Pegida-Demonstrationen wieder
salonfähig gemacht wird, weiter angefeindet und womöglich - siehe der Fall
Khaled B. in Dresden – denen womöglich Schlimmes und Unaussprechliches zugefügt
wird. Unaussprechlich darf es gar nicht heißen, man darf es nicht unter den
Teppich kehren, man muss es benennen: die also hier verfolgt, erschlagen und
getötet werden.
Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass für
viele Mitgefühl bedeutet, die Grenzen zuzumachen und das Fremde abzuwehren.
Bloß nicht in Kontakt kommen mit dem „Anderen“. Mir wird nicht nur schlecht, sondern angesichts einer solchen Frechheit werde ich wahnsinnig wütend. Wüsste ich nicht, dass es auch noch andere liberale und weltoffene Menschen dort draußen gibt, solche zu Beispiel, die die großen Wahrzeichen einer Stadt in Dunkelheit hüllen, um der fremdenfeindlichen Demonstration davor keine Leuchtbühne zu bieten - ich wäre an meiner Wut schon erstickt. Falls es also manchen noch nicht aufgefallen ist: jetzt ist es Zeit sich den richtigen Weg herauszusuchen, sich gegen den Hass zu wenden und die Wut zu schlucken, dafür für mehr Miteinander zu werben.
Die Welt ist nicht nur durch
das Internet, sondern auch durch die Möglichkeit einfacher zu reisen, einfacher
über Grenzen hinwegzukommen, weil sie offen sind, so
zusammengerückt, dass wir es besser wissen sollten, dass wir erkennen sollten:
sie sind nicht „die anderen“, sondern wir.
[...]
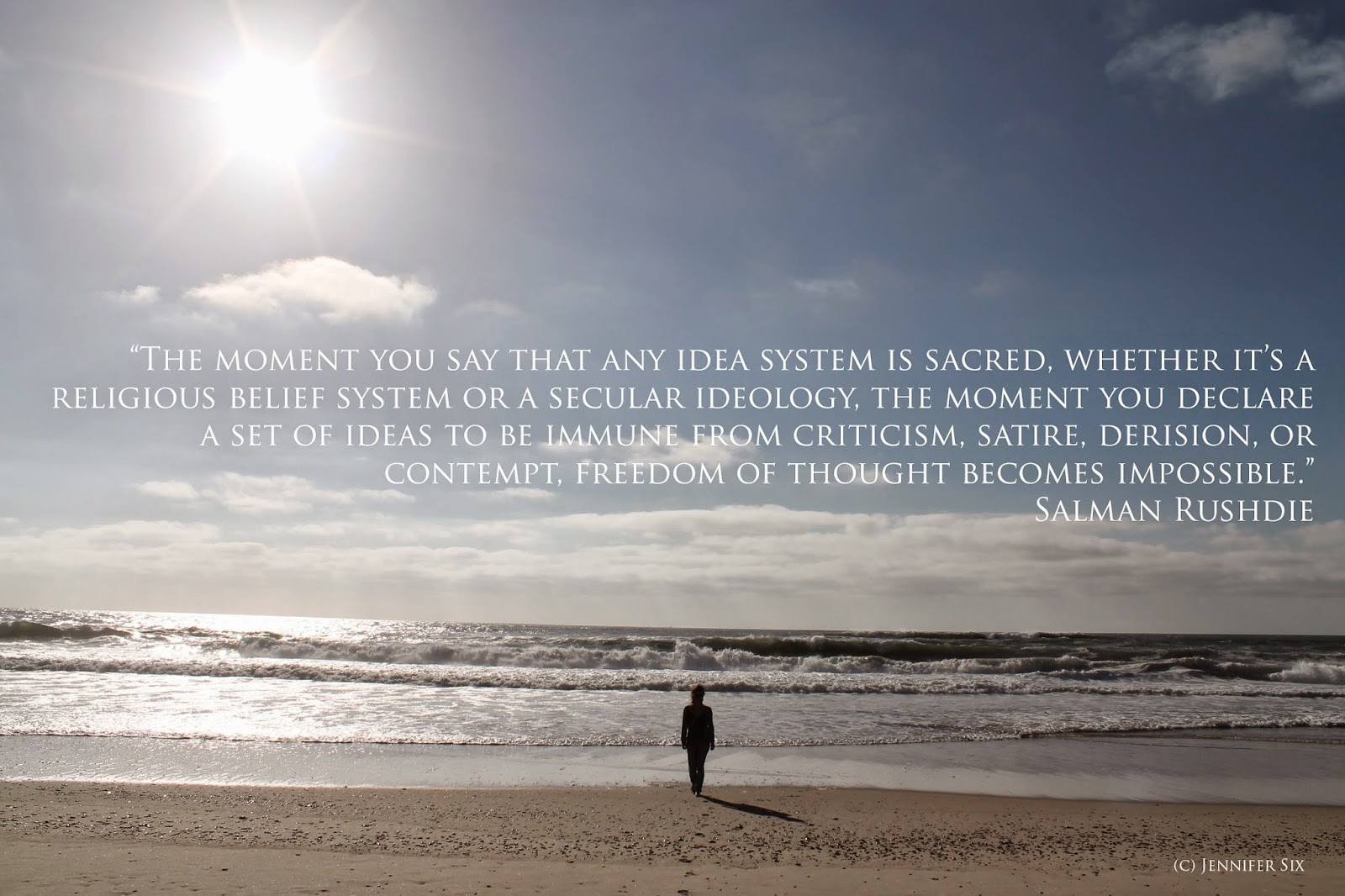
Kommentare
Kommentar veröffentlichen